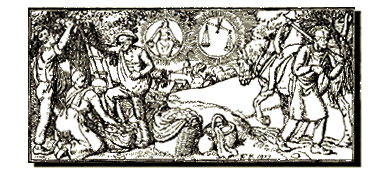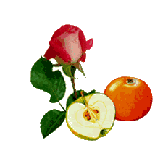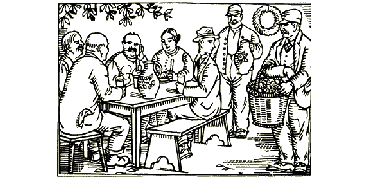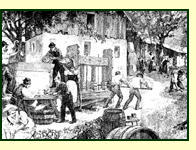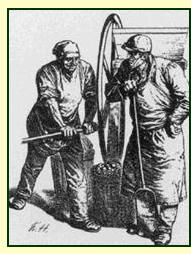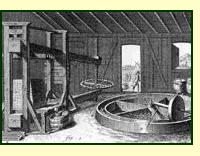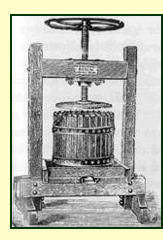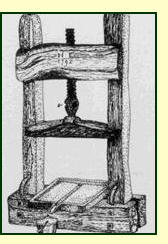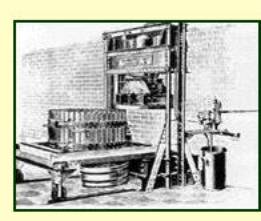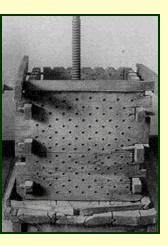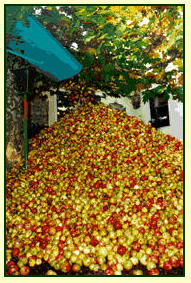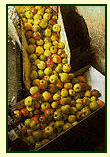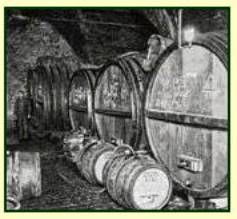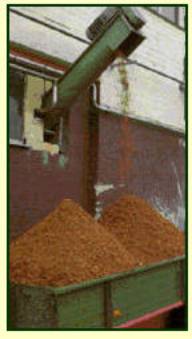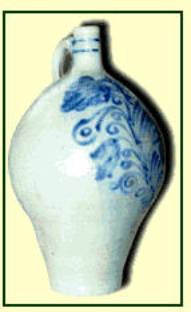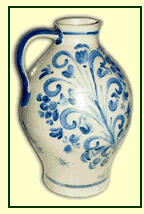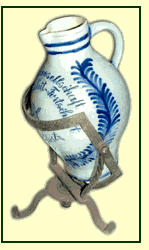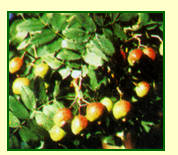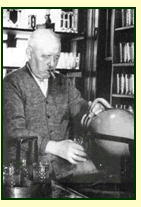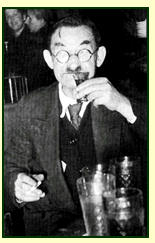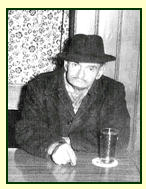|
Wirtschaften
Wirte, Gäste und ihr Verhalten
|

|
|

|
Wo´s Kränzche
hängt...
Den
Apfelwein lernt man am besten in seiner Atmosphäre kennen. Dazu muß
man wissen, wo die richtigen Apfelweingaststätten sind. Manche der
entsprechenden sind gar nicht so leicht ausfindig zu machen, da sie
weder durch besonders schöne Häuser noch durch stolze
Wirtshausschilder auffallen, sondern oft nur an einem grünen Kranz
(Symbol des Frankfurter Wahlspruchs „Lewe un lewe lasse“), mit
Bembel oder Apfel über der Eingangstür zu erkennen sind und damit
kundtun:
hier wo´s Kränzche hängt, da wird
ausgeschenkt.
|

|
|
Angeordnet
wurde das Heraushängen des Fichtekranzes um 1641. Früher gab es in
Frankfurt die Heckenwirtschaften. Die Weingärtner auch „Häcker“
genannt (daher der Name „Hecke“), verzapften ihren eigenen,
selbstgekelterten Äpfelwein in ihrem Haus, meist in den Parterrelokalitäten
ihrer Behausungen, die sonst als Wohnräume dienten. Das war meist die
ausgeräumte Wohnstube, wurde diese zu klein, wurde auch der Flur und
die nach oben führende Treppe zu Wirtschaftszwecken herangezogen. Später
kam ein Schankraum dazu, der aber auch nur sehr einfach eingerichtet
war: ein Schanktisch, dahinter die „Spühlbrenk“ mit Trocken- und
Ablaufbrett. Auf dem Schanktisch der Faulenzer als Einschenkhilfsgerät,
in dem der Bembel (auch heute noch) steht. Natürlich waren diese ersten
|

|
|
Wirtschaften
eher spartanisch als komfortabel eingerichtet, aber das Publikum fühlte
sich dort wohl und ein echter Ebbelweiwirt will nicht protzen. Er sagt
sich: „Mei guder Schobbe lobt sich von selbst“. Und wirklich, wo es
heute noch einen guten Schoppen gibt, sind die Gaststätten oder Gärten
auch immer gut besucht von freundlichen, gemütlichen Menschen, von
denen wir später noch berichten werden.
|

|

|
|
Kommen wir aber erst einmal zu den Wirten,
denn sie sind
ein Kapitel für sich - und darum sollen
sie auch eins haben.
|

|
|
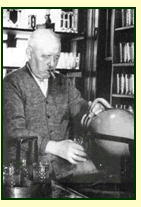
|
Im
allgemeinen zeichneten sie sich früher nicht durch übergroße Höflichkeit
aus, sondern eher durch Grob- und Derbheit. Sie meinten: zu höflich is
albern.
Manche von ihnen haben es durch ihre Grobheit
zur örtlichen Berühmtheit gebracht. Sie fühlten sich in der Gaststube
als absoluter Herrscher, und ihre Gäste hatten sich in den Wünschen
und Forderungen danach zu richten, was der Wirt bereit war zu geben. War
ein Gast mit der Auswahl nicht recht zufrieden, bekam er zu hören:
„Wann Ihnen des net basst, fressese dehaam“! Dies oder ein anderer
Ausspruch, wie: „Mer sin zwar grob, awwer mer maanes aach so“, kann
man auch heute noch zuhören bekommen, denn die Äpfelweinwirte, die
fast alle aus uralten Frankfurter Familien stammen, haben zwar das Herz
auf dem rechten Fleck, jedoch sind sie mit dem Mundwerk nicht verlegen,
wenn man sie herausfordert.
|

|
|
Sie
sind bodenständig verwurzelt, halten auf Tradition und das Brauchtum.
Die 65 Äpfelweinwirte, die in der 1919 gegründeten
„Vereinigung der Äpfelweinkeltereien mit eigenem Ausschank Frankfurt
am Main und Umgebung e. V. “ sind, bemühen sich, auf die Qualität
des Stöffche zu achten. Außerdem sind die Äpfelweinwirte von jeher
selbstbewußt genug, um sich auch mit der Obrigkeit anzulegen. Daran hat
sich bis heute nichts geändert.
|

|

|
|
Ob es um die
Steuer geht, um die Konzession, oder um Auflagen vom Gewerbe- und
Ordnungsamt, man scheut sich nicht, notfalls auch selbst den Gang zum
Kadi anzutreten.
Schlußfolgernd: Der dumme Spruch „Wer nichts
wird, wird Wirt“, trifft auf die Äpfelweinwirte nun wirklich nicht
zu, da sie ihr Metier voll und ganz im Griff haben.
|

|
|
Gäste
und ihr Verhalten
|

|
|
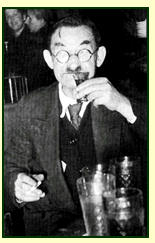
|
Apfelwein
trinkt man nicht, und saufen tut man ihn schon gar nicht, das machen nur
die, die nichts davon verstehen. Sondern der Beginn der Prozedur wird
mit einem einfachen : „Mer gehn zum Äppelwei, gehst de mit?“ angekündigt.
Der Akt der Flüssigkeitsaufnahme selbst wird
dann bezeichnet mit Petze, Robbe oder Schlotze usw. Man gibt sich mehr
oder weniger so wie man ist, möglichst ohne den Nachbarn auf den Wecker
zu fallen, „die hawwe nämlich selbst was zu lache“. Ohne
Unterschied des Standes sitzt man beim Äpfelwein zusammen.
Man kann dieses einmalige Milieu nicht bunt
genug schildern, man muß es selbst erlebt haben, wie sie auf den langen
harten Bänken bis tief in die Nacht „hocken“, die gerippten Gläser
umfassen und sich zutrinken. Eine einzige große Gemeinschaft von
friedlichen „Berjer“, die ihren „Schoppe petze“.
|

|
|
Versuchen
Sie nicht als Fremder „frankforterisch auf hochdeutsch zu babbele“,
sonst sind Sie ein „Klugschisser“. Der Frankfurter liebt das
Ungezwungene und drückt sich deutlich aus. Es darf auch ruhig mal
lauter werden und man haut sich auch mal auf die Schenkel. Aber jede
Ausgelassenheit findet ihre natürlichen Grenzen irgendwo vorm
Nachbartisch. Umgekehrt ist oberste Verhaltensregel immer Toleranz, auch
wenn sie manchmal ein bißchen strapaziert wird. Wird es gar zu
„doll“, lassen sie das den Wirt besorgen.
|

|
|
Ein
echter Frankfurter kennt natürlich seinen Äpfelwein und liebt ihn über
alles. Er kennt alle Äpfelweinlokale weit und breit, hibb der Bach,
dribb der Bach und drumherum. Selbstverständlich hat er auch sein
Stammlokal, wo er „dahaam“ ist und seinen angestammten Platz zur
bestimmten Uhrzeit behauptet; der Wirt könnte seine Uhr danach stellen,
so pünktlich stehen die Gäste vor der Tür.
Wer
Stille sucht und in sich selbst einkehren will, sollte am Nachmittag
oder frühen Abend zum Äpfelwein gehen, „schee ruhig un gemiedlich“.
Das ziehen die Geschworenen vor. Geschworene,
was ist das, wird man sich fragen, das sind Kenner, die sich ein Urteil
über den Äpfelwein erlauben können.
|
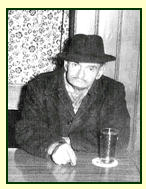
|

|
|
Wenn sie länger
sitzen, sind es „Brenner“. Die „Rundbrenner“ petzen zwei
Anstandsschoppen, verabschieden sich nach Hause - und schwenken gleich
darauf in der nächsten Zapfstelle die Gurgel.
Da
die Frankfurter ein goldiges Gemüt haben, lassen sie auch die Fremden,
die „Eigeplackte“, die „Messfremde“ und die „Zugeloffene“
sich bei ihnen am Tisch niedersetzen. Bald werden sie in das Gespräch
einbezogen, denn der Frankfurter „babbelt“ gern. Mit „Ei gude - wo
komme se denn her?“ wird die nun abendfüllende Unterhaltung
eingeleitet, man rückt näher zusammen und nach etlichen Schoppen Äpfelwein
wird immer lebhafter „schläächtgeschwätzt“ wie mit uralten
Bekannten. Apropos „Babbeln“, es ist unhöflich, einen
Nicht-Frankfurter darauf aufmerksam zu machen, daß er kein Deutsch
kann. Die meisten merken es im Laufe des Abends ohnehin selbst.
|

|
|

|
Der
Äpfelweintrinker bevorzugt heute einen aromatischen und spritzigen Äpfelwein
mit einer feinen Fruchtsäure, vor allem, nachdem auch die Damenwelt
Geschmack am Äpfelwein und seinem Millieu gefunden hat. Früher gingen
bekanntlich die Herren allein zu ihrem Schoppen, nur sonntags durften
auch die Frauen mit. Die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert,
heute gehen die jungen und die immer jungbleibenden Damen selbstverständlich
auch alleine zum Äpfelwein.
|

|
|
Ein
echter Äpfelweingeschworener trinkt seinen Äpfelwein nur pur.
Autofahrer trinken „Gespritzte“,
der Äpfelwein ist dann mit Mineralwasser verdünnt. „Herrengespritzter“,
das ist Apfelwein mit Sekt gespritzt.
„Süßgespritzter“
ist verpönt. Mutet keinem Äpfelweinwirt zu, seinen guten Schoppen mit
Limonade zu verpanschen! Gäste, die es trotzdem verlangen, werden wie
Adam und Eva aus dem Äpfelweinparadies vertrieben.
In den jungen Kreisen der Banker und Yuppies hat
der Äpfelwein das Modewort „Äppler“
erhalten.
|

|
|
Wer
Bier trinken will, soll in eine Bierschwemme gehen, es ist ein sehr
degoutanter (ekelhafter) Anblick, wenn auf einem blank gescheuerten
Apfelweintisch Bierflaschen stehen.
In einer echten Apfelweinwirtschaft wird Bier
absolut verpönt und erst garnicht ausgeschenkt, allenfalls Malzbier für
Kinder und werdende Mütter. Es muß aber nachgewiesen werden, daß es
sich wirklich um solche Personen handelt.
|

|

|
|

|
Zum
Apfelwein muß man etwas essen, damit man eine Grundlage hat und nicht
schon beim zweiten Schoppen das Gleichgewicht verliert.
Beliebte Kleinigkeiten sind Brezeln, Hartekuchen
(Zimtgebäck), Kümmelweck, Zöpf und Makronen. Sie werden vom „Brezzelbub“
gebracht, der seine Runden durch die Wirtschaften zieht. Man kauft sie
direkt aus seinem Korb, der meist gut gefüllt ist.
Wer größeren Hunger verspürt, der kann sich
mit Frankfurter Spezialitäten wie Rippchen oder Haspel mit Kraut,
Ochsenfleisch, Zunge mit grüner Soße, Fleisch- und Rindswurst,
Frankfurter Würstchen und natürlich nicht zu vergessen, „Handkäs
mit Musik“ sättigen.
Die Speisekarten der Apfelweingaststätten sind
mittlerweile umfangreicher geworden, so daß man auch Gebackenes und
Gebratenes bekommt. Jedoch empfiehlt sich immer die jeweilige Spezialität
des Hauses. Diese Wahl wird selten enttäuscht!
|

|
|
Vor
dem Heimgehen nimmt man gern noch einen Rollschobbe, dabei tranken früher
mehrere Personen den letzten Schoppen aus einem gemeinsamen Glas - heute
bekommt humanerweise jeder Gast ein eigenes Glas. An der Theke können
Sie auch beim Vorbeigehen noch „aan zum Abgewehne“ nehmen, das ist
dann der Drollschobbe, dann trollt man sich.
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|